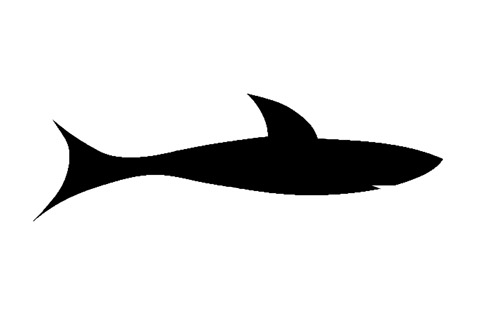Teil 3: Die letzten 1000 Meilen - Kenterung!
Ich mußte mitten in das Zentrum eines Tiefdruckgebietes gesegelt sein, da ich während der gesamten Nacht ständig Gewitter an Backbord querab hatte, während ich dahinrauschte. Ich war viel zu aufgeregt, um müde zu sein, obwohl es mir vorkam, als könnte ich dem Sturm niemals entkommen. Das war das erste mal, daß ich meine Sorgleine verwendete, um mich einzupicken – und das war auch gut so, da mich andernfalls eine große wohlgezielte Welle über Bord gepült hätte.
Im Morgengrauen befand ich mich unter einer großen schwarzen Wolkenmasse, die aussah, wie das Lehrbuch-Beispiel einer Kaltfront. Aufgewühlte See, strömender Regen und böige Winde folgten mir, egal welchen Kurs ich steuerte. Als ich den Wolken endlich entkam, fand ich nur noch leichte Winde bei steiler Welle vor und konnte beidrehen, um zu schlafen.
Es war mittlerweile der 6. September und mir war seit dem 3. September keine Positionsbestimmung mehr gelungen. Ich versuchte, so weit nördlich wie möglich zu steuern, um die Azoren zu umschiffen. Meine Bestimmung am 7. September ergab, daß ich die Azoren mit ungefähr 100 Meilen Abstand passiert hatte. Ich hatte in vier Tagen 400 Meilen zurückgelegt, davon ungefähr 20 Stunden beigedreht oder mit verminderter Fahrt. Stürme helfen beim Meilenfressen – nur noch 1300 Meilen bis England.
Während der nächsten drei Tage segelte ichimmer wieder in die Rückseite meines Tiefdruckgebietes hinein, das offensichtlich auch auf dem Weg nach England war. Endlich ließ ich es hinter mir und verbrachte ein paar Tage in schneller und bequemer Fahrt unter Selbststeuerung.
Am 11. September waren es nur noch weniger als 1000 Meilen bis Falmouth und ich öffnete mein zweites Überraschungspaket. Vier verschiedene Sorten Brot in Dosen; himmlisch nach meiner Keks-Diät. Gelegentlich war ich von dem Gedanken an Essen regelrecht besessen, obwohl ich mich eigentlich während der gesamten Überfahrt gut ernährte. Ich hatte in Bermuda ein paar hübsche Mädchen kennengelernt, die meine Fantasie angeregt hatten, aber nach einigen Tagen auf See verschob sich meine Begierde aufs Essen. Ein Psychologe hätte vermutlich die Rangfolge der Gelüste deuten können – da ich alleine und abgeschieden war, stand das Essen an erster Stelle!
Während der nächsten Woche streifte ich ständig Tiefdruckgebiete und Fronten, überwiegend unter nordwestlichen Winden, weshalb ich die meiste Zeit dicht geschotet unterwegs war – gut für die Selbststeueranlage, aber nasse und unruhige Segelei. Bei solchem Wetter blieb ich die meiste Zeit in der Kabine und verbrachte die Zeit mit Lesen, Essen und Schlafen. Ich wurde immer unwilliger, das Ölzeug anzulegen und draußen an Deck nach dem Rechten zu sehen.
Am 17. September stand ich ca. 350 Meilen vor Falmouth, mitten in der vorhergesagten Zugbahn eines Sturms. Das ist der Letzte, dachte ich bei mir, wenn ich den hinter mir habe, kann ich es mir an Land gemütlich machen, was mir zunehmend erstrebenswert vorkam. Ich hoffte, daß der Sturm vorüber sein würde, bis ich mich dem Kontinentalsockel näherte, wo die Wassertiefe des Atlantik zum Ärmelkanal hin drastisch abnimmt und kurzen, steilen Seegang erzeugt.
Gegen 23:00 Uhr war der Sturm direkt über mir und ich steuerte die ganze Nacht hindurch nur unter Fock. Im Morgengrauen wurden die starken Böen seltener und ich beglückwünschte mich, es geschafft zu haben. Es lief eine schwere See mit brechenden Wellen achterlich von Steuerbord heran. Ich war in erleichtereter und entspannter Stimmung, als mich ein Brecher von Steuerbord plötzlich breitseits zu den Wellen herumschlug. Es entstand keinerlei Schaden und ich nahm mir vor, bei nachlassendem Wind mehr Segel zu setzen, um in Fahrt und manövrierfähig zu bleiben. Ich war immer noch mit 4-5 Konoten unterwegs, aber die Wellen kamen allzu leicht über.
Plötzlich brach eine riesige Welle von Steuerbord über das Heck. Ich erinnere mich an den Anblick einer Riesenmenge von Schaum leewärts unter mir, als wir nach Backbord rollten, dann atmete ich Seewasser ein. Wir kenterten komplett durch, und bis mir klar wurde, was passiert war, hatten wir uns schon wieder aufgerichtet und ich befand mich immer noch eingepickt im Cockpit, klatschnaß.
Wir waren entmastet – ein Teil lag samt Baum an Deck, der Rest befand sich im Wasser. Ich verfluchte meine eigene Nachlässigkeit und schaute in der Kabine nach. Alles war in Unordnung, aber wenigstens in trockener Unordnung, was mich sehr beruhigte.
Ohne Mast und Segel lag das Boot recht sicher bei - ab und zu von einem Brecher getroffen, der uns heftig umherrollte. Nachdem ich den zweiten Teil des Mastes geborgen und unter Deck aufgeräumt hatte, machte ich mir ein ordentliches Frühstück und riggte einen Behelfsmast auf. Ich musste irgendwie dieser unangenehmen Gegend des Ozeans entfliehen. Eine Positionsbestimmung im weiteren Tagesverlauf ergab, dass ich mich an der Kante des Sole-Plateaus befand, wo der Atlantik aus einer Tiefe von 4000 Metern auf 110 Meter ansteigt, und das auf einer Strecke von nur zehn Meilen.
Indem ich einige Zentimeter des längeren oberen Mast-Anteils absägte, konnte ich die unbeschädigten Unterwanten sowie ein improvisiertes Vorstag am vorhandenen Bugbeschlag verwenden. Das Ding aufzustellen, war aber eine ganz andere Geschichte. Das Boot rollte immer noch heftig in der steilen See, und alle zwei bis drei Minuten brach eine Welle komplett über das Top. Ein außenstehender Beobachter hätte mich wahrscheinlich für einen Komiker gehalten, der einen betrunkenen Stabhochspringer parodiert. Da es dunkel wurde, entschloß ich mich stattdessen zu einer ausgedehnten Nachtruhe.
Am nächsten Morgen hatten Wind und Seegang beträchtlich nachgelassen und ich konnte den Mast endlich stellen, nachdem ich den Fuß an Deck festgebunden hatte. Da der Lümmelbeschlag gebrochen war, musste ich den Baum am Mast festlaschen, worauf ich ein bisschen Spannung aufs Vorliek bekommen konnte. Das Segel war sehr bauchig, aber wir kamen in Bewegung. Ich setzte eine schlecht stehende Sturmfock und stellte erfreut fest, dass die Shark sich selbst stabil auf Halbwindkurs einsteuerte. Von sich aus ging sie nicht viel höher heran.
Die Windfahne war abgerissen und der Heckkorb dabei erheblich verbogen worden, weshalb ich froh war, nicht die ganze Zeit von Hand steuern zu müssen. Auch wenn das Unterwasserschiff, wie sich später herausstellte, stark von Entenmuscheln bewachsen war und trotz meines Notriggs legte ich täglich zwischen 55 und 70 Meilen zurück – leider Richtung Frankreich, da die nordwestlichen Winde anhielten.
Ich konnte während des Segelns schlafen, überwiegend nur tagsüber, da eine Menge Fischerboote unterwegs waren, und ich nicht wollte, dass ihnen eine Shark ins Netz ging.
Am Abend des 20. befand ich mich nahe genug an der französischen Küste, um die Leuchtfeuer direkt südlich gegenüber dem Lizard Point zu sehen und ich hoffte auf südwestliche Winde. Erst um Mitternacht des 24. konnte ich das Feuer des Leuchturms am Lizard Point unter niedriger Wolkendecke ausmachen. Ich hatte bis dahin unter nördlichen Winden ost- und westwärts kreuzen müssen. Die Nächte waren mittlerweile erheblich kälter geworden, und ich konnte an Deck nicht längere Zeit ohne Unterkühlung ausharren.
Nachdem ich am 25. fast den ganzen Tag damit verbacht hatte, in Sichtweite der englischen Küste auf und ab zu kreuzen, startete ich schließlich den Außenbordmotor. Da er die ganze Überfahrt in einem Schapp unter einer Handbreit Salzwasser zugebracht hatte, war ich erstaunt, dass er überhaupt ansprang.
Als die Dunkelheit anbrach, warf ich Anker in der Mündung des Helfard Flusses südlich von Falmouth. Von grünen Hügeln umgeben, im Anblick der Robben im Fluß und des Rauches, der aus den Schornsteinen der Hütten aufstieg, sowie der geschäftig umherschwimmenden Seevögel erschien es mir als der friedlichste Ort auf der Welt. Ich schlief gut!
Um acht Uhr wurde ich durch ein fröhliches „Eos ahoi!“ geweckt. Ich schaute nach draußen und sah ein großes Zollboot dicht neben mir. Die Besatzung hatte meine US-Flagge bemerkt und kam an Bord, um mich einzuklarieren. Von diesem Augenblick an begegneten mir nur noch nette und gastfreundliche Menschen – Cornwall ist trotz des sommerlichen Tourismus von Fischfang und Landwirtschaft geprägt und erwies sich als gute Wiedereinführung nach England. Vom Personal der Hafenmeisterei bis zu den Einheimischen wiederfuhr mir nur Gutes.
Als ich später am Tag an Land ging und bärtig und schmutzig in gelbes Ölzeug und schwarze Gummistiefel gekleidet die Hauptstraße entlang lief, war ich sehr verlegen und kam mir fremdartig vor wie ein Wesen von einem anderen Stern (ein Vollbad und eine Rasur heilten mich von dieser Wahrnehmung). Nach zwei Monaten des Nichtgebrauchs waren meine Beine wackelig und ich brauchte eine ganze Woche, um mich zu erholen. Die andere Merkwürdigkeit war ein heftiges Verlangen nach Graubrot und Butter, welche in Falmouth problemlos erhältlich waren!
Links:
Homepage der Deutschen Shark-24 Klassenvereinigung e.V.
Homepage der Kanadischen Shark-24 Klassenvereinigung.
Homepage der Internationalen Shark 24 Klassenvereinigung.
Homepage von Mr. Shark & Sohn (Bodo Günther Marinedepot).
Widmung: Diese Website ist für Jupp Geiermann.