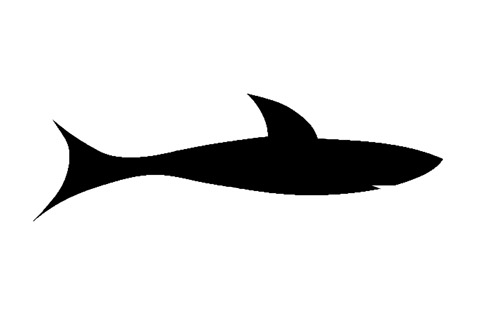Teil 2: Auf dem Atlantik - die ersten 1000 Meilen
Am 13. August füllte ich in der Frühe meine Wasservorräte auf und verließ St. George’s Richtung England. Als ich die Zufahrt verließ, kam mir dasselbe Kreuzfahrtschiff entgegen. In vier Tagen war es nach New York und wieder zurück gefahren!
Eine steife Brise aus Südwest blies bereits seit einigen Tagen, und als ich auf Nordwest-Kurs den Schutz der Inseln verließ, nahmen die achterlichen Wellen deutlich zu. Ich setzte den Spinnacker und steuerte bis in die Nacht von Hand, um den günstigen Wind voll auszunutzen, danach überließ ich das Boot unter Fock der Selbststeueranlage. Mit hoher nachlaufender See neigte die Shark stark zum Gieren. Die von hinten herannahenden Wellen waren höher als meine Windfahne, so dass sich in den Wellentälern Verwirbelungen bildeten, die das Schlingern noch schlimmer machten. Ich konnte nur einen geraden Kurs steuern, indem ich den Ruderausschlag mit einer Leine an der Pinne auf 10 Grad in jeder Richtung beschränkte. Das Boot lief unter Vorsegel stabil auf Selbststeuerung, aber bei weniger als 5 Knoten Fahrt wurde sie dann ziemlich von überkommenden Wellen umhergeworfen.
Das erste Etmal betrug 120 Meilen, die nächsten fünf Tage war der Wind jedoch schwach und umlaufend. Der Seegang brauchte eine ganze Weile, um sich zu legen und es gibt nichts Unangenehmeres, als in einem leichten Segelboot ohne Wind in hoher Dünung zu liegen. Das waren die Kalmen, sowohl geographisch als auch seelisch [Doldrums (engl.) = Kalmengürtel, Stille, Ruhe, Niedergeschlagenheit, Depression; Anm. d. Übers.]. Ich las „Zwei Jahre vor dem Mast“ und mich beschlich die Vermutung, dass ich die Fortsetzung dazu schreiben könnte. An einem Tag trieb ich 8 Meilen rückwärts Richtung Bermuda. Ich war froh über die Taschenbücher und frustriert darüber, meine Vorräte und mein Trinkwasser aufzubrauchen, ohne voranzukommen. Das einzig Gute war, dass das flaue Gefühl, welches ich am ersten Tag nach dem Ablegen in Bermuda verspürt hatte, in dem Maße verschwand, in dem ich mich dran gewöhnte, wieder auf See zu sein.
Am Sonntag, dem 19. August, kam endlich etwas Wind auf, und ich konnte weitersegeln. Es war das erste mal, dass ich den Spinnacker die ganze Nacht unter Selbststeuerung gesetzt lassen konnte. Bei ruhiger See war die Windsteuerung nicht überlastet. Bis zur nächsten Nacht hatte der Wind zugenommen mit Böen bis zu 30 Knoten und ich entschloß mich, mit geborgenen Segeln beizuliegen, indem ich die Pinne leewärts festlaschte. Das Boot ging gut durch die Wellen, und unter Deck war es gemütlich. Ich war erleichtert und auch zuversichtlich, dass ich auf diese Weise Stürme abwettern könnte.
Während der nächsten Tage kam ich gut voran, zumindest bis zum Abend des 23. August. Ich döste in der Kabine, als das Boot anfing, ziellos vom Kurs abzuweichen. Ich sprang ins Cockpit, um zu sehen, was los war, und stellt fest, dass beide Ruderbeschläge abgebrochen waren. Das Ruder hing nur noch an der Pinnenarretierung und an den Hydraulik-Schläuchen der Selbststeuer-Anlage. Während es rasch dunkel wurde, barg ich Groß- und Vorsegel und nahm alles inklusive Ruder für die Nacht mit in die Kajüte. Wind und Seegang nahmen wieder zu, aber das Boot lag sogar ohne Ruder und Segel gut bei. Gelegentlich drehte eine achterlich querab hereinbrechende Welle das Boot komplett herum („Reiche die andere Wange!“). Am nächsten Tag war das Wetter für Reparaturarbeiten zu rauh, so daß ich die meiste Zeit im Bett verbrachte, dem einzigen Platz, an dem mir die Bootsbewegungen nichts ausmachten.
Am nächsten Tag setzte ich das gereffte Groß um nahm es mittschiffs ganz dicht, um die Rollbewegungen zu dämpfen. Dann machte ich mich daran, aus meinem Brydon Boy-Anker vom Danforth-Typ Ruderbeschläge anzufertigen. Hierzu war eine Menge unerquicklicher Säge-Arbeit zu leisten, die den ganzen Tag in Anspruch nahm. Am darauffolgenden Tag war es wieder zu rauh, aber am Tag danach begann ich damit, von Hand 6 mm-Löcher in die aus dem Anker herausgeschnitzte 13 mm dicke Stahlplatte zu bohren. Auch dies erwies sich als fiese Arbeit, da ich zwischen 20 und 30 Löcher bohren mußte. In der Hölle würde ich wahrscheinlich gezwungen, bei 45 Grad im Schatten mit ungeeignetem Handwerkszeug Ruderbeschläge aus Ankern herzustellen... Mir war klar, daß ich am Bruch des Ruderzapfens selbst Schuld war. Durch mein balanciertes Ruder hatten sich wahrscheinlich die einwirkenden Kräfte verdoppelt und ich hatte einige schlecht geschweißte Verstärkungen an den werksseitigen Bügeln angebracht, was letztendlich den Bruch begünstigte.
Am nächsten Tag baute ich alles zusammen – es war auf jeden Fall stabiler als das Original. In diesem Moment wurde ich von einem Fisch gebissen. Ich benutzte einen Spanner, um Bolzen unterhalb der Wasserlinie festzuziehen, als ein Fisch, nicht größer als 40 cm, scheinbar neugierig, aber in Wahrheit hungrig, heran geschwommen kam. Er biß mich ins Daumengelenk, so daß es blutete. Ich ließ den Spanner bei einer Wassertiefe von 600 Meter aus der Hand fallen. Als der Fisch Anzeichen machte, für eine zweite Portion zurückzukommen, klopfte ich ihm mit einem kleinen Hammer ein paar mal sachte auf den Kopf – danach war er friedlicher.
Ich wurde mit den Reparaturen gerade rechtzeitig fertig. Es gab eine Sturmwarnung für mein Fahrtgebiet, und während des gesamten Folgetages nahmen Wind und Seegang stetig zu. Bei Einbruch der Nacht entschloß ich mich, erneut beizuliegen. Ich barg die Segel, baute die Windfahne ab und legte mich in die Koje. Abgesehen vom Einschlag vereinzelter brechender Seen war es ruhig und ich schlief gut.
Um 1.30 Uhr wachte ich auf, um festzustellen, daß wir fast durchgekentert waren. Ich blickte auf eine Reihe von Gegenständen hinab, die auf dem Kabinendach lagen. Das Leesegel hielt mich und bevor ich so ganz verstand, was los war, richtete sie sich wieder auf. Ich konnte die Fallen immer noch schlagen hören, so daß ich davon ausging, daß der Mast noch stand. Ich machte mich daran, die Kabine aufzuräumen. Das Unangenehme war, daß es jederzeit wieder passieren könnte. Die einzigen Schäden unter Deck betrafen den Schirm meiner Öllampe (gesprungen), zwei Eier (aufgeschlagen) - und meine Zuversicht (angeschlagen). Da entschloß ich mich, künftige Stürme vor Top und Takel abzulaufen. Der Mast selbst war unbeschädigt, aber der Radarreflektor war fortgespült worden.
Der Tintenstrich meiner Barographen-Aufzeichnung zeigte, daß die Kenterung am Tiefpunkt des Luftdruckabfalles geschehen war. Der Sturm war schnell aufgezogen, und die Wellenhöhe hatte kaum mehr als drei Meter betragen (es fiel mir damals schwer, Wellenhöhe und Windgeschwindigkeit abzuschätzen, und das geht mir auch heute noch so).
Das Ruder und seine Aufhängung waren unversehrt, aber beim Wiederaufrichten hatte die Mechanik der Selbststeuerung schwere Schäden davongetragen. Ich mußte so lange von Hand steuern, bis der Seegang so weit nachließ, daß ich eine Reparatur vornehmen konnte. Gegen 6 Uhr nahm ich wieder Fahrt auf, vor allem, um das unangenehme Rollen des beiliegenden Bootes zu verringern.
Nachdem ich den ganzen Tag gesteuert hatte und die Nacht beigedreht verbracht hatte, tauschte ich am nächsten Tag alle defekten Teile der Selbststeuerung aus. Ein großes Schiff näherte sich, um nachzusehen, ob alles in Ordnung war. Da ich mir angewöhnt hatte, unbekleidet zu segeln, wurde ich überrascht. Bis ich samt Hose zurück an Deck kam, hatten sie ihren ursprünglichen Kurs wieder aufgenommen.
Nach dem Sturm herrschten eine Zeit lang schwache nordöstliche Winde vor. Ein ausgedehntes Hochdruckgebiet, welches in den USA zuvor für eine Hitzewelle verantwortlich gewesen war, zog über mich hinüber Richtung England. Während eines Wolkenbruches sammelt ich über das Großsegel mehr als 20 Liter Regenwasser, was meine Sorgen in Bezug auf Trinkwasserknappheit milderte. Ich hatte während der Hitzeperiode fast vier Liter Wasser am Tag statt der veranschlagten zwei verbraucht.
Um diese Zeit erreichte ich die 1000 Meilen-Marke und öffnete eines der Überraschungspakete. Ich sprach einen Segen für die Spender aus und speiste die nächsten zwei Tage fürstlich.
Drei Tage lang zwangen mich entgegenkommende Winde, südöstlich Richtung Azoren (die ich nicht anlaufen wollte) abzudrehen, aber dann kam ein südöstlicher Wind auf, der stetig stärker wurde. Um in dem zunehmenden Seegang gut voranzukommen, steuerte ich von Hand vom Mittag bis zum Abend des Folgetages. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Wind Sturmwindstärke erreicht, und ich blieb unter gerefftem Groß in Fahrt.
Ich mußte mitten in das Zentrum eines Tiefdruckgebietes gesegelt sein, da ich während der gesamten Nacht ständig Gewitter an Backbord querab hatte, während ich dahinrauschte. Ich war viel zu aufgeregt, um müde zu sein, obwohl es mir vorkam, als könnte ich dem Sturm niemals entkommen. Das war das erste mal, daß ich meine Sorgleine verwendete, um mich einzupicken – und das war auch gut so, da mich andernfalls eine große wohlgezielte Welle über Bord gepült hätte.
Links:
Homepage der Deutschen Shark-24 Klassenvereinigung e.V.
Homepage der Kanadischen Shark-24 Klassenvereinigung.
Homepage der Internationalen Shark 24 Klassenvereinigung.
Homepage von Mr. Shark & Sohn (Bodo Günther Marinedepot).
Widmung: Diese Website ist für Jupp Geiermann.